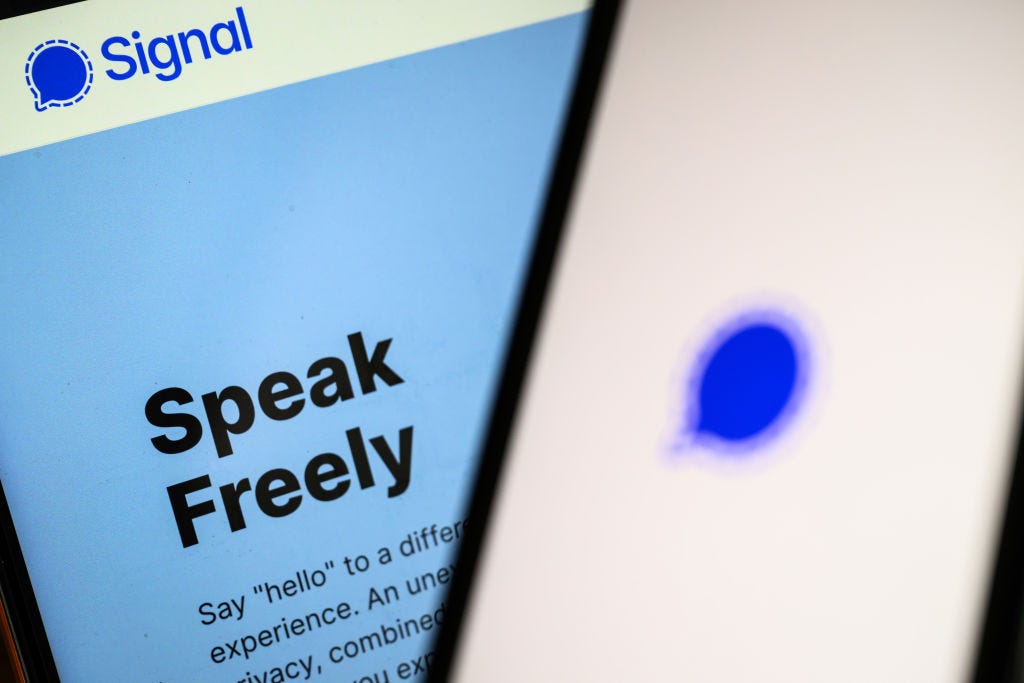Für J. D. Vance ist Europa der Feind
Europa steht nun vor einer klaren Wahl: völlige Abhängigkeit oder radikale Neuerfindung.
Niemand, der Donald Trump kennt, konnte ernsthaft erwarten, dass seine zweite Amtszeit ein Spaziergang für Europa wird. Und doch ist das Ausmaß, in dem seine Regierung ihre altbewährten Verbündeten jenseits des Atlantiks geradezu vorsätzlich vor den Kopf stößt, wirklich atemberaubend.
Trump hat sich nicht nur zögerlich gezeigt, was die Unterstützung der Ukraine angeht, oder für einen Waffenstillstand gedrängt; er hat Wolodymyr Selenskyj im Oval Office in einem denkwürdigen Auftritt zurechtgewiesen und Russland gleich zu Beginn der Verhandlungen massive Zugeständnisse gemacht. Er hat nicht nur europäischen Staaten Druck gemacht, mehr für ihre Verteidigung auszugeben; er hat Dänemark wiederholt damit gedroht, dessen Souveränität zu verletzen – indem er de facto die Annexion Grönlands ins Spiel brachte. Und schließlich hat er nicht einmal versucht, einen gemeinsamen Kurs in der Zollpolitik gegenüber China zu finden, um zentrale Industrien in die westliche Allianz zurückzuholen. Stattdessen hat er klar gemacht, dass er ebenso harte Zölle gegen die EU (und Kanada) verhängen will.
Bislang schien mir die beste Erklärung für diese bemerkenswerten Entwicklungen in Trumps Weltbild zu liegen. Ich habe in einem meiner Texte argumentiert, dass er ein stolzer Vertreter der Nullsummenlogik ist – in der der Gewinn der einen Seite zwangsläufig der Verlust der anderen ist. Und dass er die Welt in Einflusszonen aufgeteilt sieht – ein Denken, das sowohl seine Gleichgültigkeit gegenüber der Verteidigung der Ukraine (oder Taiwans) erklärt als auch seine Bereitschaft, mit Machtmitteln Vorteile für die USA in Grönland (und Panama) herauszupressen.
Aus dieser Perspektive sieht Trump Länder wie Frankreich oder Deutschland nicht als Verbündete – wie frühere amerikanische Präsidenten es taten. Aber er sieht sie auch nicht wirklich als Feinde. Für ihn sind sie einfach nur mögliche Quellen für Profit.
Die gestrige Schlagzeile, dass die Regierung versehentlich geheime Informationen an einen prominenten US-Journalisten weitergegeben hat, legt nahe, dass selbst diese Einschätzung noch zu optimistisch war. Denn die Debatte in dem veröffentlichten Gruppenchat macht deutlich: Teile der Regierung – angeführt von Vizepräsident J. D. Vance – vertreten gegenüber Europa eine noch feindseligere Haltung.
Die Geschichte des wohl berüchtigtsten Signal-Chats in der Geschichte der App ist inzwischen weitgehend bekannt. Offenbar hatte Michael Waltz, der Nationale Sicherheitsberater, eine Chatgruppe mit den ranghöchsten Entscheidungsträgern der Trump-Regierung erstellt, um Angriffe auf die Huthis zu besprechen. Dummerweise fügte er dabei auch Jeffrey Goldberg hinzu – Chefredakteur des „Atlantic“ und langjähriger Trump-Kritiker. Und in dem Chat ging es nicht nur um vage Infos oder grundsätzliche Überlegungen – es wurden detaillierte Angriffspläne diskutiert, deren Veröffentlichung die Operation gefährdet und US-Soldaten in Lebensgefahr gebracht hätte. Das ist bemerkenswert, weil es zeigt: Im Weißen Haus regiert das Dilettantentum. Warum diskutieren hochrangige Regierungsmitglieder wie der Vizepräsident, der Außenminister und der Verteidigungsminister streng geheime Operationen über einen unsicheren Messenger? Wie zum Teufel konnte man aus Versehen einen Journalisten hinzufügen, der für seine Trump-Abneigung bekannt ist? Und warum hat es niemand bemerkt?
Aber was mich am meisten an diesem Chat überrascht hat, war, wie sehr er die Feindseligkeit der Regierung – insbesondere von Vance – gegenüber Europa offenlegt. Als Waltz den Signal-Chat anlegte, war die Entscheidung, die Huthis anzugreifen, offenbar längst gefallen. Spätere Kommentare von Stephen Miller deuten darauf hin, dass es dazu bereits ein Treffen im Situation Room gegeben hatte. Der Präsident hatte abgesegnet. Aber einer war offenbar noch nicht überzeugt.
„3 Prozent des US-Handels laufen durch den Suez“, warnte Vance. „40 Prozent des europäischen Handels. Es besteht ein echtes Risiko, dass die Öffentlichkeit das nicht versteht oder warum das notwendig ist … Ich bin mir nicht sicher, ob dem Präsidenten bewusst ist, wie sehr das seiner derzeitigen Linie zu Europa widerspricht.“ Anders gesagt: Vance argumentierte nicht nur, dass Amerika in der Region keine bedeutenden Eigeninteressen habe; er schien vielmehr zu sagen, dass allein die Tatsache, dass der Einsatz europäischen Interessen dient, ein Grund dagegen sei.
An dieser Stelle schalteten sich andere Gruppenmitglieder ein, um für den Angriff zu plädieren. Verteidigungsminister Pete Hegseth betonte, die Sicherung der Schifffahrtswege sei ein „zentrales nationales Interesse“. Waltz, der Nationale Sicherheitsberater, folgte Trumps offenbarem Wunsch, Europa sämtliche Kosten für US-Militärhilfe aufzubürden, und unterstützte Hegseth: „Ob jetzt oder in ein paar Wochen – es werden die USA sein müssen, die die Schifffahrtsrouten wieder öffnen. Auf Wunsch des Präsidenten arbeiten wir mit Verteidigungs- und Außenministerium daran, die Kosten zu ermitteln und den Europäern in Rechnung zu stellen.“
Daraufhin lenkte Vance ein. Aber dass er bei allem Unbehagen letztlich zustimmte, machte seine Haltung kaum weniger deutlich: „Wenn ihr meint, wir sollten es tun, dann los. Ich hasse es einfach, Europa schon wieder aus der Patsche zu helfen.“ Hegseth (vielleicht, um Vance das Eingeständnis der Niederlage zu erleichtern) stimmte zu: „VP: Ich teile deine Abneigung gegen das europäische Trittbrettfahren vollkommen. Es ist ERBÄRMLICH.“
Es ist schwer zu begreifen, was Vance zu seiner Feindseligkeit gegenüber Europa antreibt.
Amerikanischer Unmut über „europäisches Trittbrettfahren“ ist nicht neu, parteiübergreifend und absolut nachvollziehbar; auch Barack Obama und Joe Biden haben versucht, die Verbündeten zu mehr Eigenverantwortung zu bewegen. Selbst Vances berüchtigte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz könnte man – mit viel Wohlwollen – als ruppige, aber gut gemeinte Mahnung an Freunde interpretieren. (Die Europäer waren zu Recht entsetzt, dass Vance den Ukrainekrieg kaum erwähnte – und dass ausgerechnet ein Vertreter einer Regierung, die selbst massiv gegen Meinungsfreiheit vorgeht, zum Thema sprach, verlieh seiner Rede einen deutlichen Beigeschmack von Heuchelei. Dennoch traf er einen wunden Punkt: In vielen EU-Staaten wird die Meinungsfreiheit inzwischen tatsächlich stark eingeschränkt.)
Vances private Äußerungen haben für mich eine ganz andere Dimension. Sie lassen erkennen, dass sein Ziel nicht allein darin besteht, die Europäer zu mehr Eigenverantwortung in der Verteidigung zu bewegen – und nicht einmal nur darin, rechtspopulistische Kräfte zu stärken, die er offenkundig als Trumps natürliche Verbündete auf dem Kontinent betrachtet; vielmehr geht es ihm darum, Europa zu schwächen und zu bestrafen.
Das sollte Europa Angst machen. Meine Sorge ist nicht mehr, dass zentrale Figuren der US-Regierung Europa nicht als Verbündeten sehen – sondern dass sie Europa womöglich als Feind betrachten.
Wenn der Vizepräsident der Vereinigten Staaten nicht bereit ist, einen vergleichsweise simplen Luftschlag gegen die Huthis zu unterstützen, um den globalen Handel zu sichern, wie wahrscheinlich ist es dann, dass er im Falle eines russischen Angriffs einem NATO-Mitglied wie Estland zu Hilfe eilt? Und wenn Vance aktiv darauf aus ist, Europa zu schwächen, dann wirken selbst bislang undenkbare Szenarien – wie die Annexion von Teilen des Territoriums eines langjährigen Verbündeten, wie Trump sie im Fall Grönland offenbar in Erwägung zieht – nicht mehr ganz so abwegig.
Der bemerkenswerte Gruppenchat zeigt aber immerhin: Vance hat momentan nicht das letzte Wort in der Regierung. Auch wenn er den Schlag gegen die Huthis skeptisch sah, setzten sich andere Stimmen durch. Der Angriff fand wie geplant statt.
Doch es wäre gefährlich, Vances aktuellen oder zukünftigen Einfluss zu unterschätzen. Vance hat sich klar dafür entschieden, Trump treu zur Seite zu stehen – und dieser weiß das zu schätzen. (Das berüchtigte Treffen mit Selenskyj im Oval Office eskalierte auch deshalb, weil Trump seinen Vizepräsidenten gegen subtile Kritik des Gastes verteidigen wollte.) Vances Gewicht innerhalb der Regierung ist real.
Und darüber hinaus ist Vance derzeit wohl der aussichtsreichste Kandidat, Trump zu beerben. Vizepräsidenten haben traditionell einen Vorteil im Rennen um die Nominierung. Und auch wenn Vance im Wahlkampf oft belächelt wurde – bei den Wählerinnen und Wählern kam er erstaunlich gut an: Am Wahltag hatte er bessere Zustimmungswerte als Kamala Harris, Tim Waltz – oder sogar Trump selbst. Die republikanischen Vorwahlen 2028 werden sicher ein großes Feld anziehen – und Trump könnte sich letztlich auch für jemand anderen entscheiden, etwa seinen eigenen Sohn. Aber im Moment ist Vance der logische Favorit. (Und angesichts von Trumps Alter besteht durchaus die Möglichkeit, dass Vance schon vor Januar 2029 Präsident wird.)
Für Europa bedeutet das mindestens zwei Dinge. Erstens: Der Kontinent braucht dringend eine Vance-Strategie. So wie europäische Staatschefs lange gelernt haben, mit Trump umzugehen, müssen sie nun auch lernen, wie sie mit Vance klarkommen.
Und zweitens: Europa steht vielleicht bald noch viel mehr allein da, als es Politik und Öffentlichkeit bislang realisieren. Wer jetzt immer noch glaubt, dass diese US-Regierung Europa im Ernstfall zu Hilfe eilt, macht sich etwas vor.
Wenn es an all dem überhaupt etwas Positives gibt, dann vielleicht dies: Die offen zur Schau gestellte Feindseligkeit des Weißen Hauses gegenüber dem Kontinent könnte Europas Führung endlich zum Umdenken zwingen. Wie ich vor ein paar Wochen geschrieben habe, muss sich Europa an eine einfache Lektion erinnern: Entweder man gestaltet Geschichte – oder Geschichte gestaltet einen selbst.
Wenn europäische Länder vermeiden wollen, zum Spielball von Wladimir Putin und Xi Jinping – oder auch von J. D. Vance und Pete Hegseth –, zu werden, müssen sie grundlegende Veränderungen einleiten.
Es wird nicht reichen, einfach nur mehr Geld fürs Militär auszugeben. Europa braucht tiefgreifende Wirtschaftsreformen, Spitzenuniversitäten – und der Kontinent muss sich zu einem echten Zentrum für globale Innovationen entwickeln, vor allem in Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz. Das ist, freundlich ausgedrückt, keine leichte Aufgabe. Aber immerhin sind die Optionen jetzt klar: Europa steht vor der Entscheidung zwischen völliger Abhängigkeit oder radikale Neuerfindung. Wenn Europas Politiker – und Wähler – diese Realität weiterhin verleugnen, werden sie sich am Ende nur selbst die Schuld geben können.
Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.