Die dritte Demütigung der Menschheit
Was wird von unserem Selbstbild übrig bleiben, wenn künstliche Intelligenz besser Gedichte schreibt oder Filme macht als wir?
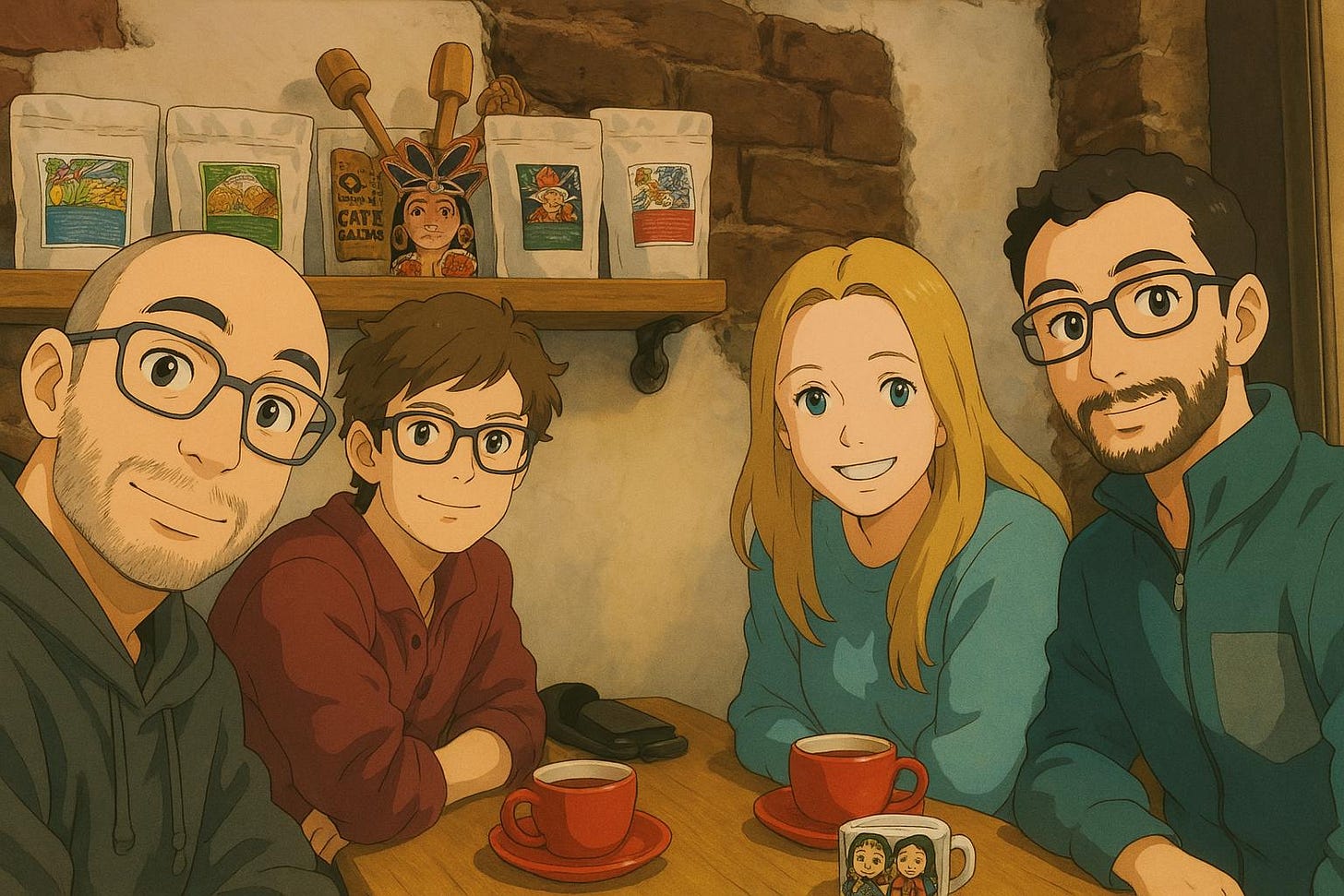
Vor Kurzem postete ein Liebhaber der Antike auf X vier Übersetzungen einer Passage aus der Odyssee und bat seine Follower, ihren Favoriten zu wählen. Drei stammten von einigen der bekanntesten Übersetzer, die sich je an die Aufgabe gewagt haben, Homers schöne Sprache in akkurates und idiomatisches Englisch zu übertragen: Robert Fitzgerald, Richmond Lattimore und Emily Wilson. Die vierte kam von einem der führenden Modelle für künstliche Intelligenz: GPT4o von OpenAI.
Das Ergebnis der informellen Umfrage war eindeutig: GPT4o ging klar als Sieger hervor und erhielt mehr als doppelt so viele Stimmen wie der menschliche Zweitplatzierte. Zumindest nach dem Geschmack der breiten Masse schlagen Chatbots inzwischen selbst die fähigsten menschlichen Übersetzer.
Und das ist kein Ausrutscher. In einer ganzen Reihe kreativer Bereiche, die lange als Inbegriff menschlicher Ausdruckskraft gelten, reicht künstliche Intelligenz heute an das Können der talentiertesten Künstler heran.
Nehmen wir nur mal die Dichtung. In einer kürzlich in Nature erschienenen Studie zeigten Brian Porter und Edouard Machery von der University of Pittsburgh, dass die Teilnehmenden nicht erkennen konnten, ob die Gedichte, die sie bewerteten, von Menschen oder Maschinen verfasst worden waren. Sie konnten die Werke berühmter menschlicher Autoren wie Sylvia Plath, Walt Whitman oder Lord Byron nicht von Nachahmungen unterscheiden, die ein Chatbot erzeugt hatte – das GPT-3.5-Modell von ChatGPT, das inzwischen nicht einmal mehr zur technologischen Spitzenklasse zählt.
Schlimmer noch: Die Teilnehmer der Studie verrieten unabsichtlich ihre eigene Spezies. Sobald sie wussten, woher die Gedichte stammten, zogen sie die menschlichen Originale vor. Wenn sie jedoch nicht wussten, welches Gedicht von wem war, entschieden sie sich durchgehend für die von der KI verfassten Imitationen. „Menschen bevorzugen KI-generierte Lyrik gegenüber von Menschen verfasster Lyrik und bewerten KI-Gedichte durchgehend höher als die Werke bekannter Dichter – und das über eine Vielzahl qualitativer Kriterien hinweg“, schreiben Porter und Machery.1
Lyrik ist eher die Regel als die Ausnahme. Tatsächlich, so betonen die Autoren der Studie, wird es zunehmend schwieriger, überhaupt noch ein menschliches Tätigkeitsfeld zu finden, in dem künstliche Intelligenz dem Menschen nicht überlegen ist: „KI-generierte Bilder sind von der Realität nicht mehr zu unterscheiden. KI-Gemälde werden häufiger für menschliche Kunstwerke gehalten als tatsächlich von Menschen geschaffene Bilder. KI-generierte Gesichter gelten öfter als echt als echte Fotos von menschlichen Gesichtern. Und KI-generierter Humor ist genauso lustig wie menschlich erdachte Witze.“
Eine der drängendsten Fragen, die durch die atemberaubend schnellen Fortschritte der künstlichen Intelligenz aufgeworfen werden, betrifft die Zukunft von Bürojobs – insbesondere in kreativen Berufen.
Kürzlich veröffentlichte OpenAI ein Modell, dessen Fähigkeit zur Bildgenerierung sich drastisch verbessert hat. Über Nacht hat dieses kleine Taschen-Illustrationsstudio es Unternehmen ermöglicht, Aufgaben zu erledigen, für die sie zuvor Designer oder Illustratoren hätten anstellen müssen. Selbst Projekte, für die man früher ganze Teams aus Models, Fotografen und Account Executives gebraucht hätte – etwa die Produktion einer professionellen Werbeanzeige –, könnten schon bald komplett von KIs übernommen werden. Werden also bald Millionen Kreative ohne Job dastehen?
Eine der Ironien dieses Moments könnte darin bestehen, dass der unerwartet schnelle Fortschritt der KI die Hierarchien von Fähigkeiten auf den Kopf stellt, die wir lange als gegeben betrachtet haben. Noch vor ein paar Jahren war der allgemeine Konsens: Neue Technologien würden zuerst die Jobs von LKW-Fahrern und Bauarbeitern ersetzen; „niedrig qualifizierten“ Menschen in solchen Berufen wurde geraten, doch einfach Programmieren zu lernen. Jetzt dämmert eine neue Realität: Gerade die angeblich „hochqualifizierten“ Büroberufe – darunter Ärzte, Juristen und Softwareentwickler ebenso wie Illustratoren und Werbetexter – könnten sich als noch leichter ersetzbar herausstellen.
Diese wirtschaftlichen Umwälzungen dürften zutiefst disruptiv sein. Je nachdem, wie wir mit ihnen umgehen, könnten sie die Menschheit befreien – oder uns alle verarmen lassen. Und doch habe ich in den letzten Wochen über eine eher immaterielle Veränderung nachgedacht, die mir auf ihre Weise genauso bedeutsam erscheint. Was macht es mit unserem Selbstverständnis als Spezies, wenn wir – und dieser Tag rückt schnell näher – schlechter als Maschinen werden in Tätigkeiten, die wir lange als das ureigene Wesen des Menschseins betrachtet haben? Vom Schreiben eines Gedichts bis zum Komponieren eines Liedes?
Die Technologie hat es dem Menschen ermöglicht, einen Großteil des Planeten seinem Willen zu unterwerfen.
Im Jahr 1500 lebten weniger als fünfhundert Millionen Menschen auf der Erde. Die von menschlichen Siedlungen beherrschte Fläche machte nur einen kleinen Bruchteil des bewohnbaren Landes aus. Selbst in den reichsten Regionen lag die Lebenserwartung unter 35 Jahren. Etwa jedes zweite Neugeborene erlebte nicht einmal seinen 15. Geburtstag.
Ein halbes Jahrtausend später haben Menschen ihren Lebensraum grundlegend verändert. Heute leben über acht Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde. Abgesehen von Ozeanen und Regenwäldern, Wüsten und Berggipfeln dominieren menschliche Siedlungen den Großteil der Landmasse. Selbst in Afrika, dem mit Abstand ärmsten Kontinent, kann der durchschnittliche Bewohner heute damit rechnen, älter als sechzig Jahre zu werden. Die Zahl der Babys, die an Krankheit, Hunger oder Gewalt sterben, ist nur noch ein Bruchteil dessen, was sie einmal war – weniger als eines von zwanzig Neugeborenen stirbt vor seinem 15. Geburtstag. Es ist leicht nachzuvollziehen, warum manche Wissenschaftler vorgeschlagen haben, unser geologisches Zeitalter das Anthropozän zu nennen – die Ära, in der der Mensch zum entscheidenden Faktor in der Gestaltung der Umwelt geworden ist.
Und doch gibt es einen Sinn, in dem die Menschheit während ihrer fünfhundert Jahre des Triumphs auch Demut gelernt hat. Denn genau jene wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es den Menschen ermöglichten, die Erde ihrem Willen zu unterwerfen, zeigten ihnen zugleich, dass ihr Platz im Universum längst nicht so zentral ist, wie sie einst geglaubt hatten. Wie Sigmund Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse schrieb: „Die Menschheit hat im Laufe der Zeit von der Hand der Wissenschaft zwei große Kränkungen ihres naiven Selbstgefühls erfahren müssen.“
Die erste Kränkung der Menschheit kam im 16. Jahrhundert, als Kopernikus darlegte, dass sich das Universum nicht um die Erde dreht. Das zwang die Menschen – in Freuds Worten – dazu, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, „dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern ein winziges Teilchen eines in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems.“
Die zweite Kränkung kam im 19. Jahrhundert, mit Charles Darwins Evolutionstheorie. Wie Freud es ausdrückte, wurde dem Menschen damit „das besondere Vorrecht genommen, als etwas Besonderes erschaffen worden zu sein, und er wurde auf seine Abstammung aus dem Tierreich zurückgeführt – mitsamt einer unauslöschlichen animalischen Natur.“
Freud postulierte außerdem eine dritte Kränkung, die er als den „bittersten Schlag“ für unsere Spezies sah. Seine eigene Arbeit am Unbewussten, so behauptete er – nicht ohne eine gute Portion Ego –, zeige „dass der Mensch nicht einmal Herr im eigenen Hause ist, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewußt in seinem Seelenleben vorgeht.“
Die Einsicht, dass Menschen sich nicht all ihrer Gedanken und Wünsche bewusst sind, ist zweifellos bedeutsam. Doch sie ist kaum vergleichbar mit den Entdeckungen von Kopernikus und Darwin. Und in jener Form, in der Freud sie darstellte – mit seiner Betonung des Es und des Über-Ichs, des Unbewussten und der Traumdeutung – ist auch diese Einsicht längst denselben Weg gegangen: widerlegt und entzaubert durch strengere wissenschaftliche Forschung.
Die dritte große Kränkung der Menschheit steht noch aus. Doch die rasanten Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz deuten darauf hin, dass sie unmittelbar bevorstehen könnte. Denn was sollte als die dritte – und womöglich grundlegendste – Kränkung der Menschheit gelten, wenn nicht die Tatsache, dass Maschinen bald besser sein könnten als wir in jenen kreativen Tätigkeiten, die wir lange als den Inbegriff menschlicher Schaffenskraft betrachtet haben?
Viele kluge Köpfe verweigern sich noch immer der Realität und Bedeutung künstlicher Intelligenz. Sie verweisen auf ihre Schwächen, etwa die gelegentliche Neigung zur Halluzination. Sie behaupten, bei KI handle es sich keineswegs um eine echte Form von Intelligenz, sondern lediglich um einen „stochastischen Papagei“ – einen seelenlosen Algorithmus, der bloß darauf trainiert ist, das nächste Wort in einem Satz oder das nächste Pixel in einem Bild vorherzusagen.
Es ist vielleicht unvermeidlich, dass Menschen, die sich durch solch rasante Fortschritte in besonders persönlichen, menschlichen Bereichen bedroht fühlen, sich verzweifelt an jede Erklärung klammern, die diese Wunder irgendwie als nicht ganz real erscheinen lässt. Doch leider laufen die gängigsten Argumente letztlich auf wenig mehr hinaus als auf zum Scheitern verurteilte Versuche der Selbstberuhigung. In ein paar Jahrzehnten – vielleicht sogar in ein paar Jahren – wird man sie allgemein als das erkennen, was sie sind: eine Form des Selbstbetrugs, die in der Tradition jener Priester und Moralisten steht, die sich weigerten zu akzeptieren, dass der Mensch vom Affen abstammen könnte.
Möchten Sie (oder jemand, den Sie kennen) meine Artikel und Interviews auf Englisch oder Französisch lesen? Abonnieren Sie sich gerne bei meinen entsprechenden Substacks!
Ja, KI-Modelle haben noch immer gewisse grundlegende Schwächen – und ihre Neigung zu halluzinieren gehört eindeutig dazu. Besonders wenn man ChatGPT nach einem konkreten Fakt oder einem bestimmten Zitat fragt, kann es passieren, dass es etwas erfindet, nur um den Nutzer zufriedenzustellen. So real diese Probleme auch sind, sie sind in einem so frühen Entwicklungsstadium durchaus zu erwarten. Jahrzehntelang hatten Autos Motoren, die oft gar nicht erst ansprangen und alle paar Kilometer schlapp machten; heute kann man zehntausende Kilometer fahren, ohne sich ernsthaft Sorgen machen zu müssen. Davon auszugehen, dass Chatbots in ein paar wenigen Jahren rasanten Fortschritts grundlegende Probleme wie Halluzinationen nicht überwinden könnten, ist mehr als voreilig.
Noch weniger überzeugend ist das Argument, dass KI-Chatbots gar keine „echte“ Intelligenz besitzen könnten, weil sie ja lediglich Algorithmen seien, die Muster in riesigen Datensätzen erkennen und wiedergeben. Dieses Argument beruht auf einem grundlegenden Missverständnis: Es verwechselt die Funktionsweise eines Systems mit dem, was dieses System leisten kann.
Auch Neurowissenschaftler verstehen das menschliche Gehirn bis heute nicht vollständig. Formeln wie „Was zusammen feuert, verdrahtet sich“ sind bestenfalls grobe Vereinfachungen eines nach wie vor rätselhaften Prozesses. Klar ist aber: Das Wunder unseres Geistes ist letztlich das Ergebnis einer hochkomplexen Anordnung physischer Materie. Und trotzdem würde niemand ernsthaft Shakespeares Intelligenz absprechen, nur weil seine Sonette durch elektrochemische Impulse in einem neuronalen Netzwerk entstanden sind, dessen genaue Funktionsweise wir nur teilweise verstehen. Seine Kreativität auf die Mechanik seiner Biologie zu reduzieren, hieße völlig am Punkt vorbeizugehen – es wäre, um mit der Philosophie zu sprechen, ein Kategorienfehler.
Dasselbe gilt für künstliche Intelligenz. Es stimmt, dass Chatbots technische Systeme sind und dass ihr Funktionieren sich im Prinzip algorithmisch beschreiben lässt. Es stimmt auch, dass ihre Form der Intelligenz wahrscheinlich eine andere ist als die des Menschen; ein Freund von mir, der bekannter Neurowissenschaftler ist, ist überzeugt, dass ihre Denkweise sich sowohl von der von Säugetieren als auch von der von Kopffüßern unterscheidet – und sie damit zur dritten Form von Intelligenz auf der Erde macht. Aber wie beim Menschen wäre es ein Fehler zu glauben, dass eine Beschreibung der physikalischen Prozesse, die ihrer Funktionsweise zugrunde liegen, irgendwie schmälert, was sie zu leisten vermögen.
Begriffe wie „Intelligenz“ haben keine feste Bedeutung. Wenn es jemandem hilft, seine Angst vor dem rasanten Fortschritt von KI zu lindern, indem er darauf beharrt, ein auf Algorithmen basierendes System könne per Definition nicht „intelligent“ sein, dann ist das letztlich ein nicht widerlegbares Argument. Doch die eigentliche Herausforderung für unser Selbstverständnis liegt nicht in der Arbeitsweise künstlicher Intelligenz, sondern in ihren Ergebnissen. Selbst wenn wir willkürlich beschließen, einem System, das Gedichte mit gleicher emotionalen Kraft wie jene von Whitman oder Wordsworth verfassen kann, das Prädikat „intelligent“ abzusprechen – der demütigenden Erkenntnis werden wir nicht entkommen: dass Algorithmen zu schöpferischen Leistungen fähig sind, die wir lange als rein menschliches Privileg betrachtet haben.
Ein letzter Rückzugsort bleibt.
KI-Modelle werden womöglich schon bald Gedichte schreiben können, die selbst von den größten Experten als besser bewertet werden als jene menschlicher Konkurrenz. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Scherzbold ein von ChatGPT verfasstes Gedicht – angeblich aus der Feder eines Menschen – im New Yorker veröffentlicht. (Oder vielleicht ist es weniger spektakulär ein etablierter Lyriker mit Schreibblockade und Mietschulden.) Und wo Gedichte vorangehen, sind Kurzgeschichten, Romane und vielleicht auch Filme nicht weit.
Aber Schreiben ist ein Akt der Kommunikation. Tätigkeiten wie Lyrik sind für uns Menschen bedeutungsvoll, weil sie echte Emotionen ausdrücken – Emotionen, die KI-Modelle, so gut sie auch die sprachliche Form solcher Gefühle nachahmen mögen, offenbar nicht wirklich empfinden. Wenn wir die Worte von Shakespeare oder Whitman lesen, liegt ein Teil der Faszination gerade darin, dass sie uns eine zutiefst intime Begegnung mit einem großen Geist ermöglichen, der in einer völlig anderen Zeit und Welt gelebt hat. All das sind Gründe, warum unsere Vorliebe für Kunstwerke, die wir für menschlich geschaffen halten – ob sie es nun sind oder nicht – womöglich dauerhaft bestehen wird.
Aber wird es sich dann noch gleich bedeutungsvoll anfühlen, solche Kunstwerke zu schaffen? Werden Dichter, Romanautoren, Drehbuchschreiber – und ja, auch bescheidene Verfasser von Substack-Posts – noch dieselbe Motivation verspüren, ihre Seele in einen leeren Bildschirm zu gießen, wenn die Maschinen in unseren Hosentaschen den Job besser und schneller erledigen können?
Die Menschheit hat sich damit abgefunden, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist. Sie hat Frieden geschlossen mit ihrer Herkunft aus dem Tierreich. Sicherlich werden wir auch einen Weg finden, mit der Tatsache zurechtzukommen, dass die Maschinen, die wir selbst geschaffen haben, bald besser sein könnten als wir – ausgerechnet in jenen schöpferischen Tätigkeiten, die uns am stärksten als Menschen definieren. Aber der Schlag für unser kollektives Selbstwertgefühl, wenn er kommt – und das wird er wohl bald – könnte der härteste sein, den die Menschheit je verkraften musste.
Eine gängige Reaktion darauf lautet, dass das bloß die Unwissenheit der meisten Menschen widerspiegele; wer sich wirklich mit Homer oder Whitman auskenne und ihnen mit Hingabe begegne, könne den Unterschied sicher erkennen. Vielleicht. In der Nature-Studie etwa gaben die meisten Befragten offen zu, wenig Fachwissen zum Thema zu haben. Aber obwohl es weiterer empirischer Forschung bedarf, um die Fähigkeit echter Experten zu testen, KI- von menschlich verfassten kreativen Werken zu unterscheiden, deuten die bisherigen Daten eher in die entgegengesetzte Richtung. In der Lyrik-Studie zum Beispiel schnitten Befragte mit größerem Wissen über Dichtung keineswegs besser darin ab, KI-Inhalte zu erkennen: Wie die Autoren der Studie feststellen, „hatte keiner der gemessenen Faktoren zur Dichtungserfahrung einen signifikant positiven Effekt auf die Trefferquote.“
Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.



